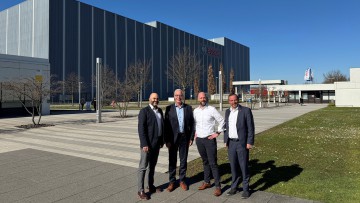Schraubenfedern
Auch Schraubenfedern in Fahrwerken sind genau genommen Verschleißteile. Sie können ermüden, korrodieren und brechen. In allen Fällen ist der Werkstattprofi gefragt, der wissen sollte, was er tut.
Am und im Pkw findet sich eine Vielzahl von Federn. Selbst auf den Ausgleich von Hubschwingungen von Karosserie und Insassen reduziert, sind es weit mehr als vier Federn, die Einfluss ausüben. Die ersten Federn am Auto sind die Reifen, erst dann folgen die Fahrwerkfedern, Zuganschlagfedern in Stoßdämpfern eingeschlossen. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der ten-denziell wachsenden Zahl von Gummi-Metall-Elementen und Stabilisatoren im Fahrwerk. Die bei Anregung durch die Fahrbahn zuletzt wirkenden Federn sind die in den Sitzkissen enthaltenen Federn.
Greift man die Fahrwerkfedern heraus, stößt man auf unterschiedliche Bauarten: Blattfedern, Drehstabfedern (Torsionsfedern), Schraubenfedern (Druckfedern), Luft- und hydropneumatische Federn. Hinzu kommen Gummifedern, die, abgesehen von Austin 7 & Co., nur als Zusatz- oder Anschlagfedern (Gummihohlfedern etc.) eingesetzt werden. Dieser Artikel soll sich nur mit Schraubenfedern beschäftigen, mit Konstruktion, Fertigung, Diagnose und Erneuerung – ein Rundumschlag.
Reduziert auf Schraubenfedern, ist die Vielfalt von Fahrwerkfedern noch immer enorm. Man unterscheidet auf der einen Seite zylindrische Federn mit konstantem oder nicht konstantem Drahtdurchmesser sowie jeweils mit konstanter oder nicht konstanter Steigung. Andererseits gibt es Formfedern wie Tonnen-, Kegelstumpf-, Doppelkegelstumpf-, Tallien- oder KMP-optimierte Federn. Das Kürzel steht für Kraftmittelpunkt, hierzu später mehr.
Formen, Endwindungen, Teller
Gebräuchliche Begriffe sind lineare und progressive Federkennlinien, womit die Abhängigkeit der Federkraft vom Federweg beschrieben wird. Folglich handelt es sich bei einer Feder mit linearer Kennlinie um eine solche mit über den Federweg kontinuierlich ansteigender Federkraft. Hingegen nimmt bei einer Feder mit pro-gressiver Kennlinie die Federkraft schneller zu als der Federweg. Bei zylindrischer Feder lässt sich eine lineare Kennlinie mit konstanter Steigung, aber nicht konstantem Drahtdurchmesser realisieren, seltener mit umgekehrten Parametern. Sind beide nicht konstant, entsteht eine Feder mit so genannter superprogressiver Kennlinie, wie sie an der Hinterachse des Ford Escort II anzutreffen ist. In jedem Fall progressiv sind die Kennlinien von Formfedern, beispielsweise von so genannten Minibloc-Federn, einer Sonderform der Tonnenfedern, verbaut u. a. an Hinterachsen von BMW- und Opel-Pkw.
Hinzu kommen spezielle Endenformen wie plan angelegt, eingerollt und plan angelegt, ein-gerollt und angelegt nach Tellersteigung, Abwälzende sowie geschliffen und angelegt. Bei Federn mit eingerolltem Ende spricht man von Pigtail-, ggf. von Doppel-Pigtail-Federn. Jede Federform lässt sich mit jeder Endform kombinieren. Kommen ergänzend Federteller zum Einsatz, kön-nen diese Außen- oder Innenzentrierungen oder auch Innenzentrierungen mit so genanntem stehenden Fangkragen aufweisen. Als Material für Schraubenfedern nutzen Hersteller wie ThyssenKrupp Bilstein (Erstausrüstung; Ersatzteilmarke: Kraemer & Freund) hoch elastische Chrom- und Siliziumstähle, beispielsweise die Sorten 55Cr3, 51CrV4 oder 56SiCr6. Der Herstellungsprozess einer Schraubenfeder setzt sich aus min-destens zehn Einzelschritten zusammen, wobei die Verfahren Warm-, Kalt/Weich- und Kalt/Hart-Formen zu unterscheiden sind. Beispiel Warm-Formen: Der erste Schritt ist das „Schälen“ des angelieferten Materials. Der Stahldraht wird in einer Art Drehmaschine mit umlaufenden Messern mindestens 0,5 Millimeter tief abgeschält, um Oberflächenfehler zu beseitigen und den benötigten Durchmesser zu erzielen. Es folgt die Rissprüfung. Anschließend wird der Draht in einem Härteofen auf ca. 880 Grad Celsius erhitzt und sein Gefüge umgewandelt, um ihn leichter wickeln zu können und das Abschrecken vorzubereiten. Das Wickeln erfolgt auf CNC-gesteuerten Maschinen, die die Genauigkeit der Erstausrüstung und Stückzahlen bis zu 600/Stunde erreichen (vgl. Bild Seite 16 unten rechts). Beim Abschrecken der geformten Feder wird diese in Öl auf etwa 80 Grad Celsius abgekühlt, wodurch sich ein martensitisches Gefüge und die typischen Eigenschaften von Federstahl einstellen. Die nächsten beiden Stunden verbringt die Feder im Anlassofen bei Temperaturen zwischen 200 und 400 Grad Celsius. Die exakt eingestellte Temperatur bestimmt die Härte der Feder. Im Idealfall ist die Feder noch nicht abgekühlt, wenn sie anschließend gesetzt, also einige Sekunden bis zum Anschlag zusammengepresst wird, um einen Höhenverlust zu erzwingen (vgl. Bilder Seite 18 oben).
Setzen der noch warmen Feder
Der Höhenverlust nimmt den Alterungsprozess vorweg, so dass die Feder im späteren Betrieb weniger an Höhe verliert, und sorgt für identische Höhen aller Federn einer Serie. Kugelstrahlen, der Beschuss der Feder mit kleinen Stahlkügelchen, verfestigt die Oberfläche und sorgt für Druckeigenspannung, was das Wachstum von Rissen verhindert. Auf besonderen Kundenwunsch erfolgt an dieser Stelle eine zweite Rissprüfung unter UV-Licht. Zur Vermeidung von Korrosion ist eine Oberflächenbeschichtung erforderlich, die als schwarze Pulverbeschichtung ausgeführt und eingebrannt wird. Eine abschließende Prüfung unter Last gewährleistet, dass das mit den Federn bestückte Fahrzeug keine schief stehende Karosserie aufweist. Zur Vermeidung von Schäden an soeben produzierten Federn wird jede Feder einzeln in Kartons ver-packt. Diese Abweichungen vom Sollmaß liegen noch innerhalb der Toleranzen:
Drahtdurchmesser: ± 0,05 mm
Außendurchmesser: ± 1,5 mm
Höhe der Feder bei Fahrzeugleergewicht: ± 5 mm
Vorsicht bei Lackabplatzungen
„Neben für die Erstausrüstung bestimmten Federn stellen wir auch serien-identische Federn für den Ersatzteilmarkt her“, sagt Rainer Popiol, Schulungsleiter bei ThyssenKrupp Bilstein. „Weil nicht jede im Ersatzteilmarkt vertriebene Feder die gleiche gute Qualität aufweist, sollten Werkstattprofis wissen, an welchen Punkten sie eine weniger gute Feder auf den ersten Blick erkennen können. Das sind vor allem Lackabplatzungen an einer neuen Feder. Weist eine Minibloc-Feder konstante Drahtstärke, geschliffene Enden und ovale Augenformen auf, handelt es sich zumindest um keine Erstausrüstungs- oder seriennahe Feder. Die gleiche Vorsicht gilt bei bunten Beschichtungen.“
Seit Jahrzehnten nehmen bei sinkendem Gewicht der Federn deren Festigkeit und Beanspruchung zu. Entsprechend sollte der Korrosionsschutz an Bedeutung gewinnen, was in der Praxis jedoch nicht immer der Fall ist (vgl. Rückrufdatenbank unter www.autoservicepraxis.de). „Federn mit einer Vergütefestigkeit größer als 2.050 Megapascal erfordern sogar einen speziellen Oberflächenschutz“, erklärt Heinz-Georg Gabor von ThyssenKrupp BIlstein. „Die Lösung ist unsere DualProtect ge-nannte Zweischichtlackierung mit Zinkprimer und Steinschläge abhaltendem Decklack.“ Besonders in harten Wintern mit viel Tau- und Streumitteleinsatz bewährt sich eine qualitativ hochwertige Federbeschichtung, die Steinschläge und korrosive Medien von der Metalloberfläche abhält. Anderenfalls bildet sich Rost, der die Zone der höchsten Druckeigenspannung – sie liegt etwa 100 Mikrometer unter der Oberfläche – schnell erreicht und dort für Spannungskonzentration an den Rostnarben und drastische Lebensdauerverkürzung der Feder durch korrosives Auflösen der Druckeigenspannung sorgt. Korrosion reduziert den Drahtdurchmesser und dieser beeinflusst die Federrate.
In der Realität deutscher Werkstätten und Autohäuser werden Schraubenfedern nur höchst selten erneuert. Selbst im Zu-sammenhang mit dem Einbau neuer Stoß-dämpfer bleiben die Federn in der Regel unbeachtet. Für eine künftig intensivere Beachtung sprechen diese Punkte:
Schraubenfedern: Verschleißteile
bei genauer Betrachtung sind Schraubenfedern Verschleißteile, sie können ermüden, korrodieren und brechen
für das Setzungsverhalten von Schraubenfedern sind Maxima festgelegt: fünf Millimeter nach fünf Jahren und zehn Millimeter nach acht Jahren
ThyssenKrupp Bilstein ordnet die Federn von Kraemer & Freund in der eigenen Er-satzteilmarkt-Nomenklatur als Bilstein B3 ein. Von Schulungsleiter Rainer Popiol und Frank Hansen, Leiter der Bilstein-eigenen Testwerkstatt, stammen diese Praxistipps für die Schraubenfeder-Erneuerung:
Elf Praxistipps aus Ennepetal
saisonale Räderwechsel sind gute Zeitpunkte zur Kontrolle der Federn
auch bei jedem Stoßdämpferwechsel die Fahrwerkfedern prüfen und spä-testens nach etwa vier Jahren oder ca. 120.000 Kilometern erneuern
die Erneuerung von Federn sollte, ana-log zu der Vorgehensweise mit Stoßdämpfern, nur paarweise erfolgen
ebenfalls analog zu Stoßdämpfern vollzieht sich die schleichende Ermüdung der Federn, die dem Autofahrer nicht auffällt und erklärungsbedürftig ist
Vorsicht beim Nebeneinanderlegen von alten und neuen Federn: womöglich ist kein Höhenunterschied feststellbar, er zeigt sich erst unter Belastung; auch das muss dem Kunden unter Umständen plausibel erklärt werden
die Position der Federnummer gibt nur im Tuningbereich, nicht aber bei einem Originalersatzteil, die Einbaulage der Feder (oben/unten) an; Orientierung alternativ an der Originalfeder oder in den Reparaturdaten
mit kürzeren Federn liegt die Karosserie eines Fahrzeugs nicht automatisch tiefer, entscheidend sind der Federntyp und die Drahtstärke
bei Opel-Pkw können die Federaugen unterschiedliche Innendurchmesser aufweisen, oft beträgt der Unterschied nur wenige Millimeter
bei VW-Pkw können in den Federtellern Anschläge integriert sein, an denen das Federende anstoßen muss
beim Einsatz eines Federspanners vor-sichtig vorgehen und die Oberflächenbeschichtung der neuen Schraubenfeder nicht beschädigen
Federn nicht werfen oder fallen lassen
Bananen-, KMP- oder SL-Feder
Eine anfangs erwähnte Sonderform der Formfeder ist die Kraftmittelpunkt-optimierte Feder (KMP-Feder). Weitere Be-zeichnungen lauten Bananen- oder SL-Feder, wobei die Banane die Federform erklärt und das Kürzel für Side loaded steht. Gemeint ist stets eine Schrauben-feder, deren Windungen nicht mehr oder weniger parallel übereinanderliegen, son-dern einen Bogen beschreiben, und die typischerweise bei McPherson-Federbeinen zum Einsatz kommt. Dort sollen auftretende Querkräfte kompensiert und die Kolbenstange des Federbeins von diesen entlastet werden. Damit verspricht man sich Verbesserung des Fahrkomforts und Reibungsminderung. Bei ThyssenKrupp Bilstein erklärt man die Federn so: „Kraftmittelpunkt-optimierte Federn (KMP-Federn) sind Federn, bei denen der Kraftmittelpunkt oder die Kraftwirkungsrichtung gezielt angelegt wird. Je nachdem, ob Querkräfte in der Feder erzeugt oder verhindert werden sollen, liegt der Kraftmittelpunkt mittig oder außermittig. Üb-licherweise werden unter KMP-Federn Federn verstanden, bei denen der Kraftmittelpunkt mindestens an einer Federseite außerhalb der Mitte gelegen ist.“
Somit ist klar, dass bei der Erneuerung von KMP-Federn auch nur wieder KMP-Federn, und diese in korrekter Einbau-lage, in Frage kommen. Solche und andere Feinheiten erfährt man übrigens bei Weiterbildung durch die Spezialisten von ThyssenKrupp Bilstein. Internetkontakt: www.bilstein.de. Peter Diehl
Leserservice
Sonderwünsche
ThyssenKrupp Bilstein vertreibt für den Ersatzteilmarkt bestimmte Schraubenfedern, ebenso wie Stoßdämpfer, über den einschlägigen Großhandel. Sind jedoch Lösungen gefragt, die nicht mit üblichen Ersatzteilen abdeckbar sind, beispielsweise Federn für einen seltenen und hochwertigen Klassiker, die nicht mehr in Serie gefertigt werden, kommt Wolfgang Meyer von K&F ins Spiel.
Kontakte:
ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH
info@bilstein.de
Tel. 02333/791-4444
Kraemer & Freund GmbH & Co. KG
Vertrieb Inland/Kundenbetreuung
Wolfgang Meyer
Tel. 0 23 31/12 08-20
wolfgang.meyer4@thyssenkrupp.com
- Ausgabe 5/2010 Seite 16 (1020.1 KB, PDF)