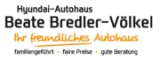Streitfälle mit dem Kunden, Teil 1
Kommt es zu einem Konflikt mit dem Kunden, ist meistens die Höhe der Rechnung Auslöser dafür. Einige Grundlagen zu den Themen Kostenvoranschlag, Abnahme und Werkunternehmerpfandrecht.
Der Ärger über eine Rechnung hat einen 64-jährigen Kunden zum Äußersten getrieben: Er zog in einem Hamburger Mercedes-Autohaus plötzlich eine Maschinenpistole und schoss wild um sich. Der Chef der Werkstatt konnte sich nur mit einem Sprung aus dem Fenster retten.“ So berichtete „Spiegel-Online“ im Dezember 2006. Zugegeben ein Extremfall, aber auch „normale“ Streitigkeiten mit Werkstattkunden sind unangenehm. Sorgfältige Kalkulation, transparente Preisgestaltung und rechtssichere Rechnungslegung helfen dabei, Konflikte zu vermeiden.
Streitpunkt Nummer eins ist die Rechnungshöhe, insbesondere wenn die Werkstatt von einem zuvor zugesagten Pauschalpreis abweichen möchte. Denn ein Pauschal- bzw. Festpreis ist ein ohne Rücksicht auf Einzelleistungen nach überschlägiger Schätzung vereinbarter Preis. Eine Abweichung hiervon im Grunde nicht möglich. Das Risiko unvorhergesehener Verteuerung der Arbeiten trägt also die Werkstatt. Die Vereinbarung eines Pauschalpreises sollte daher nur bei Kleinstreparaturen in Betracht gezogen werden oder wenn der tatsächliche Reparaturaufwand vollständig absehbar ist.
In der Regel kommt vor dem Reparaturauftrag aber der Kostenvoranschlag. Er ist eine unverbindliche fachmännische Berechnung der voraussichtlichen Kosten. Trotzdem hat sich die Vergütung grundsätzlich hiernach zu richten, d.h. die Werkstatt kann bei Rechnungsstellung nicht unbegrenzt davon abweichen. Akzeptiert wird im Allgemeinen eine Abweichung von lediglich zehn bis 20 Prozent. Sofern absehbar ist, dass diese Grenze überschritten wird, sollte unbedingt Kontakt mit dem Kunden aufgenommen werden, um Einigkeit über die weiteren Kosten zu erzielen. Sofern nämlich die genannte Kostengrenze überschritten wird, hat der Kunde das Recht, den Auftrag zu kündigen und lediglich die bisher erbrachte Leistung zu bezahlen. Sofern der Kunde erst nach durchgeführter Reparatur über die wesentliche Überschreitung des Kostenvoranschlags informiert wird (und er aus diesem Grund nicht mehr kündigen kann) entsteht ein Schadenersatzanspruch des Kunden, mit dem er aufrechnen kann. Die Werkstatt bleibt also auf den Mehr-kosten „sitzen“.
Kostenloser Kostenvoranschlag
Ein Kostenvoranschlag ist nach § 632 Absatz 3 BGB im Zweifel kostenlos zu erstellen. Das entspricht dem Gedanken, dass es sich dabei eigentlich um eine Akquisitionsleistung handelt, mit der die Werkstatt sich um den Auftrag bewirbt. Allerdings gibt es insbesondere im Unfallgeschäft die Besonderheit, dass dem Kostenvoranschlag aus Sicht des Kunden von vornherein kein Auftrag folgen soll. Der Kunde benötigt ihn lediglich als Grundlage für die fiktive Abrechnung eines Unfallschadens mit der eintrittspflichtigen Versicherung. Diese wiederum verweigert häufig (zu Unrecht) die Übernahme der Kosten des Kostenvoranschlags mit dem Hinweis auf § 632 Absatz 3 BGB. In solchen Fällen sollte die Kostenpflichtigkeit des Kostenvoranschlages ausdrücklich vereinbart werden, damit der „Zweifel“ beseitigt wird. Achtung: Eine entsprechende Vereinbarung durch allgemeine Geschäftsbedingungen ist nicht möglich, ein Aushang am Empfang oder der Auftragsannahme genügt also nicht, um den Aufwand erstattet zu bekommen.
Ohne Auftrag durchgeführte Reparaturen kann die Werkstatt grundsätzlich nicht in Rechnung stellen. Der Kunde könnte darauf bestehen, dass die durchgeführten Arbeiten wieder rückgängig gemacht werden. Sofern ein Rückbau nicht möglich ist, muss der Kunde wiederum nur die tatsächliche Wertsteigerung des Fahrzeugs bezahlen, die sich auch nach dem subjektiven Nutzen für den Kunden errechnet. Eine schriftliche Auftragsbestätigung, in der auch die Person des Auftraggebers und der Umfang der durchzuführenden Arbeiten genau bezeichnet werden, sollte daher selbstverständlich sein, um Streitigkeiten zu vermeiden.
Abnahmeverpflichtung
Die Vergütung wird mit der Abnahme des Kfz fällig. Die Abnahme ist die körperliche Entgegennahme des Fahrzeugs verbunden mit der (regelmäßig stillschweigenden) Erklärung, die Leistung entspreche im Wesentlichen der vertraglichen Vereinbarung. Der Kunde ist verpflichtet, ein vertragsgemäß repariertes Auto abzunehmen und er kann die Abnahme wegen unwesentlichen Mängeln auch nicht verweigern. Eine schriftliche Rechnung hingegen ist keine Fälligkeitsvoraussetzung für den Werklohn, wobei der Kunde aber einen Anspruch auf ordnungsgemäße Rechnungslegung hat. Barzahlung bei Abholung ist nach wie vor der gesetzliche Regelfall nach § 245 BGB. Eine spätere Fälligkeit der Werklohnforderung bedarf der vorherigen Vereinbarung. Es soll vorkommen, dass Werkstatt und Kunde eine sogenannte „Ohne-Rechnung-Abrede“ treffen. Entgegen der früheren Rechtsprechung hat aber der Kunde seit 2008 auch bei solchen Vereinbarungen in der Regel Sachmängelhaftungsansprüche (BGH, Urteil vom 24. 4. 2008 - VII ZR 42/07).
Was aber, wenn der Kunde nicht zahlen kann oder will? Das „schärfste Schwert“ der Werkstatt zur Durchsetzung berechtigter Werklohnforderungen ist das gesetzliche Werkunternehmerpfandrecht (§ 647 BGB). Sofern der Kunde bei Abholung des Fahrzeugs nicht zahlt, kann die Werkstatt die Herausgabe des Fahrzeugs verweigern. Sofern der Kunde der Ansicht ist, die Reparatur sei nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, kann er die Rechnung „unter Vorbehalt“ bezahlen. Auf diese Möglichkeit sollte der Kunde ausdrücklich hingewiesen werden. Zu beachten ist aber, dass sich das Werkunternehmerpfandrecht nur auf den konkreten Auftrag bezieht. Sollte der Kunde demnach noch ältere Rechnungen nicht bezahlt haben, kann die Herausgabe nicht verweigert werden. Hier sollte vor Annahme des neuen Auftrags die Frage der Zahlungsrückstände geklärt werden (und gegebenenfalls ein vertragliches Werkunternehmerpfandrecht vereinbart werden).
Wer ist Auftraggeber?
Achtung: das Werkunternehmerpfandrecht entsteht nur, wenn der Kunde auch Eigentümer (und nicht nur Halter oder Nutzer) des Fahrzeugs ist, ansonsten besteht nur das allgemeine Zurückbehaltungsrecht, das allerdings nicht zur Verwertung des Fahrzeugs berechtigt. Auch vor diesem Hintergrund empfiehlt sich die sorgfältige Klärung der Auftrags- und Vertretungsverhältnisse vor Auftragsannahme. Denn ein anderer Streitfall im Zusammenhang mit der Rechnung ist eben die Frage nach dem Auftraggeber bzw. Rechnungsempfänger, skizziert an folgendem Fallbeispiel: Das Fahrzeug einer Stammkundin wird mit einem kapitalen Motorschaden in die Werkstatt verbracht. Der Neffe der Kundin erteilt den Auftrag einen Austauschmotor einzubauen. Im Vertrauen auf die bisherige Geschäftsbeziehungen werden die Arbeiten ausgeführt und das Fahrzeug wird an den Neffen herausgegeben. Die Rechnung lautet auf die Stammkundin, deren Daten im System der Werkstatt hinterlegt sind. Die Kundin meldet sich daraufhin und teilt mit, dass sie keinen Auftrag erteilt hat und ihr Neffe im Übrigen mittellos ist. Was nun?
Keineswegs entstehen „automatisch“ Ansprüche gegenüber dem Eigentümer / Halter des Fahrzeugs. Die Werklohnansprüche bestehen nur gegenüber dem Auftraggeber (Neffen). In Betracht kommen könnte ein Anspruch auf Erstattung der objektiven Wertverbesserung des Fahrzeugs gegenüber dem Eigentümer, der aber nicht dem Werklohn entspricht und nur mit Hilfe eines Gutachters bestimmt werden kann. Im Zweifel sollte auf eine Vollmacht des Fahrzeugeigentümers bestanden werden oder das Fahrzeug sollte nur gegen Bezahlung der Rechnung herausgegeben werden. Jürgen Leister
- Ausgabe 9/2012 Seite 98 (261.0 KB, PDF)