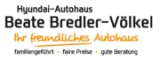Abtretung und Rechtsberatung
Zwei Urteile des Bundesgerichtshofs sind richtungsweisend beim Weg durchs juristische Minenfeld der Unfallreparatur. Doch die Versicherungen arbeiten mit neuen Tricks.
D ie seit Jahren streitigen Fragen im Zusammenhang mit der Regulierung von Unfallschäden sind geklärt. Durch mehrere grundlegende Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof (BGH) nunmehr Klarheit zur Wirksamkeit der Abtretung von Forderungen an Werkstätten und zum Umgang mit dem Rechtdienstleistungsgesetz durch Werkstätten geschafft. Aber Achtung: der Teufel steckt im Detail.
Bei der Abtretung von Forderungen handelt es sich um ein so genanntes dingliches Rechtsgeschäft. Es wirkt allen Personen gegenüber unmittelbar. Im Gegensatz hierzu verpflichtet ein so genanntes Verfügungsgeschäft nur die jeweiligen Vertragsparteien: Der Käufer wird verpflichtet zu zahlen, der Verkäufer wird verpflichtet den Kaufgegenstand zu übereignen. Dieser Unterschied ist von erheblicher Bedeutung für das zentrale Rechtsproblem der Abtretung, nämlich die Bestimmtheit der Forderung, die abgetreten wird. Sofern die Abtretungsvereinbarung nämlich nicht bestimmt genug ist, ist die Abtretung unwirksam. Mit anderen Worten: Ein Anspruch auf Erstattung der Reparatur- oder Mietwagenkosten gegenüber der Haftpflichtversicherung des Schädigers kann von der Werkstatt nicht durchgesetzt werden.
Entsprechendes Lehrgeld musste ein Kfz- Sachverständiger durch Entscheidung des BGH (Urteil vom 7. Juni 2011 - VI ZR 260/10) zahlen. Ein Unfallgeschädigter beauftragte den Sachverständigen mit der Erstellung eines Schadengutachtens und trat seine gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeugs bestehenden Schadensersatzansprüche „in Höhe der Gutachterkosten“ einschließlich Mehrwertsteuer formularmäßig erfüllungshalber an den späteren Kläger ab. Wie häufig, wurden die Kosten des Sachverständigen von der Versicherung gekürzt. Dieser ging aus abgetretenem Recht selbst gegen die Versicherung vor und verlor den Prozess durch drei Instanzen. Warum? Eben weil die Abtretung nicht bestimmt genug war.
Man stelle sich den Gesamtschaden als Kuchen vor. Dieser „Kuchen“ besteht aus Reparaturkosten, Wertminderung, Sachverständigenkosten, Abschlepp- und Bergungskosten, Unkostenpauschale und ggf. Personenschaden usw. Zwar würde einem der gesunde Menschenverstand sagen, dass doch klar ist, was die Beteiligten wollten; aber das hilft hier nicht weiter. Die Abtretung würde bezogen auf das Kuchenbeispiel bedeuten, dass der Gutachter so viel Kuchen essen darf, bis er satt ist. Welches Kuchenstück er essen kann, ergibt sich allerdings nicht aus der Abtretungserklärung („in Höhe der Gutachterkosten“). Aufgrund der gewählten Formulierung besteht daher die Gefahr, dass der Gutachter tatsächlich ein „Stückchen“ Wertminderung und ein „Stückchen“ Reparaturkosten erhält. Wegen der oben beschriebenen dinglichen Wirkung darf das aber nicht sein, da Dritte dann eben nicht wissen, was von dem Kuchen übrig bleibt. Richtig wäre gewesen, wenn sich die Abtretung ausdrücklich auf das „Kuchenstück Sachverständigenkosten“ bezogen hätte. Korrekt wäre beispielsweise folgende Formulierung gewesen:
„Hiermit trete ich die Schadensersatzforderung auf Erstattung der Kosten des Gutachten in Höhe von………… gegen den Fahrer, Halter und deren/dessen Haftpflichtversicherung aus dem oben genannten Schadensereignis erfüllungshalber an den ... (Sachverständiger) ab.“
Auch in einer anderen Streitfrage hat der BGH endlich ein Machtwort gesprochen: Werkstätten dürfen eine erfüllungshalber abgetretene Forderung einziehen, ohne dass sie dadurch gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstoßen (BGH, Urteil vom 31.1.2012, Az. VI ZR 143/11). Das Urteil erging zwar in dem konkreten Fall zu Mietwagenkosten, es lässt sich aber ohne Weiteres auf Reparaturkosten übertragen. Aber Vorsicht: neben einer wirksamen, d.h. bestimmten Forderungsabtretung ist weitere Voraussetzung, dass die Unfall-Haftung dem Grunde nach unstreitig ist, da andernfalls keine erlaubte Nebentätigkeit, sondern eine verbotene Rechtsberatung im Sinne des RDG vorliegt. Aus dem gleichen Grund verbietet sich auch eine Werbung mit „kompletter Unfallabwicklung“.
Neuer Trick der Versicherungen
Die Versicherer haben zwischenzeitlich auf das BGH-Urteil mit einem neuen Trick reagiert und wenden im Gerichtsverfahren plötzlich eine Mithaftung des Geschädigten ein, selbst wenn vorher die Haftung eindeutig war. Dieser prozessuale Einwand erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, die Abtretung anzugreifen und dem Autohaus einen Verstoß gegen das RDG vorzuwerfen. Sofern klar ist, dass dieser Einwand nur erhoben wird, um die Abtretung zu Fall zu bringen, haben sich die Gerichte bisher erfreulicherweise nicht auf die taktischen Spielchen der Versicherer eingelassen (zuletzt: LG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2012, Az. 16 O 493/11).
Jürgen Leister
Abtretung
Wichtige Rechtsbegriffe
Sofern mit Abtretungen gearbeitet wird, sollten die wichtigsten Rechtsbegriffe bekannt sein, die hier kurz erläutert werden:
Zedent: Derjenige, der eine Schadenersatzforderung abtritt; hier also der unfallgeschädigte Kunde
Zessionar: Derjenige, an den eine Schadenersatzforderung abgetreten wird, hier also zum Beispiel die Werkstatt, das Autohaus, der Autovermieter, der Abschleppunternehmer oder der Kfz-Sachverständige.
Abtretung erfüllungshalber: Die Schadenersatzforderung des Kunden gegen die Versicherung auf Erstattung z.B der Reparaturkosten geht auf den Zessionar über. Aber damit wird der Kunde nicht aus der Verpflichtung zur Zahlung für die Rechnung entlassen. Was der Versicherer nicht bezahlt, muss der Kunde also selbst zahlen. Die Werkstatt kann demnach entweder direkt gegen die Versicherung oder gegen den Kunden vorgehen.
Sicherungsabtretung: Die Sicherungsabtretung ist eine Abtretung erfüllungshalber. Sie hat aber die Besonderheit, dass erst dann aus der Abtretung vorgegangen werden kann, wenn der Kunde nachhaltig, aber erfolglos selbst zur Zahlung aufgefordert wurde. Es ist also mindestens eine erfolglose Mahnung erforderlich.
Abtretung an Erfüllung statt: Die Schadenersatzforderung des Kunden gegen die Versicherung auf Erstattung der Reparatur- und der anderen oben genannten Kosten geht auf den Zessionar über. Und der Kunde wird gleichzeitig aus der Verantwortung für die Zahlung entlassen. Er hat mit der Abtretung „bezahlt“. Was der Versicherer nicht bezahlt, muss der Kunde auch nicht zahlen (in der Praxis nicht zu empfehlen).
- Ausgabe 7/2012 Seite 60 (289.4 KB, PDF)