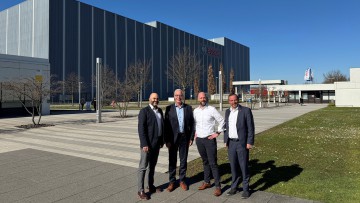Von Michael Gebhardt/SP-X
Es ist nicht lange her, da war "autonomes Fahren" das Stichwort der Stunde. Die marketinglastigen Parolen der Hersteller wollten uns glauben machen, dass wir schon in Bälde nicht mehr selbst ins Steuer greifen müssen und mit Robo-Taxis durch die Stadt kutschiert werden. Zwei, drei Jahre später klingen die lauten Töne leiser, und die angekündigte Revolution lässt immer noch auf sich warten.
Von den viel gepriesenen Fähigkeiten des Audi A8, beispielsweise, sind nur wenige bislang verfügbar. Woran es scheitert? Die Sensortechnik arbeitet immer noch nicht zuverlässig genug, die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlen, die Welt ist nicht ausreichend detailliert kartographiert, und natürlich kostet das alles auch jede Menge Geld. Es gibt also wahrlich dringlichere Baustellen, als etwa die Fahrdynamik autonomer Autos. Genau um die zu optimieren, traf sich nun aber eine Gruppe von VW-Entwicklern im portugiesischen Portimao.
Dass noch der ein oder andere Stein aus dem Weg geräumt werden muss, bis selbstfahrende Autos oder robotergesteuerte Taxis auf die Straße kommen, ist freilich auch den rund 25 Teilnehmern der "Vehicle Dynamics Convention" klar, die Volkswagen bereits zum fünften Mal abhält. Die hier auf der Rennstrecke testenden und tüftelnden Entwickler denken allerdings bereits zwei, drei Schritte voraus. Sie arbeiten in der Konzernforschung und erproben das, was in zehn, 15 oder vielleicht noch mehr Jahren auf die Straße kommt. Dass die aktuellen Schwierigkeiten bis dahin gelöst sind, setzen sie voraus – darum kümmern sich ihre Kollegen aus der Serienentwicklung.

Deshalb sind die liebevoll Walter, Norbert oder Dieter getauften Versuchsfahrzeuge auch nicht mit zahlreichen Sensoren, Lasern oder Kameras ausgestattet. Um den Rundkurs autonom absolvieren zu können, kennen die VW Golf- und Audi RS7-Prototypen den detaillierten Streckenverlauf und erhalten ihre genaue Position per GPS. Selbst irgendwelche Hindernisse, Abbiegungen oder Ampeln zu erkennen ist hier nicht gefragt. Was die zahlreichen Rechner im Kofferraum eines jeden Entwicklungsfahrzeugs aber leisten müssen, ist, die so genannte Trajektorie zu berechnen: den Weg über die Rennstrecke und die Geschwindigkeit. Derer gibt es freilich unzählige, und genau hier setzt eine Gruppe von Forschern an: Wenn alle Autos zukünftig die gleiche Fahrweise wählen – egal ob auf dem Rundkurs oder im Alltag –, fühlt es sich auch in allen Autos gleich an. Vor allem ein Konzern wie Volkswagen muss aber aufpassen, dass die Marken-DNA von Porsche, Skoda oder Audi unterschiedlich ist. Deshalb erproben die Ingenieure schon heute Möglichkeiten, welche Parameter wie verändert werden müssen, damit ein Auto einmal komfortabler, einmal sportlicher unterwegs ist. Wie genau sich ein Bentley in 15 Jahren fährt, wird hier allerdings nicht festgelegt – hier geht es darum, das Handwerkszeug zu entwickeln, mit dem die Serienentwickler schließlich die Abstimmung vornehmen können.
Wann sind die Reifen schlecht?
Eine individuelle Marken-DNA einstellen zu können, ist für den Vertrieb und das Marketing wichtig. Noch essentieller aber ist die Sicherheit. Ein anderes Entwickler-Team ist gerade daran, dem Auto beizubringen, wie es abgefahrene Reifen erkennt. Das ist im Grunde recht simpel: Der Wagen weiß anhand der errechneten Trajektorie, wo er hinfahren soll und vergleicht diese Spur schließlich mit der vom GPS-System ermittelten, tatsächlich gefahrenen Strecke. Sind die Reifen schlechter, wird es in der Kurve einen Versatz nach außen geben. Der muss freilich noch dahingehend überprüft werden, ob der Reibwert der Straße schlecht ist, also ob es glatt war; das aber ist für den Computer kein Problem. Kommt er schließlich zum Schluss, dass die Reifen schlecht sind, wird der Fahrmodus angepasst, also weniger Tempo, weniger enge Kurven. Solche Techniken kann man sich übrigens auch im nicht-selbstfahrenden Auto zu Nutze machen: Anhand von Lenkwinkel, Geschwindigkeit und weiteren Parametern lässt sich der vom Fahrer vorgegebene Kurs berechnen und mit den Ist-Werten abgleichen – gegebenenfalls könnte der Fahrer dann per Warnmeldung zum Reifenwechsel aufgefordert werden.
Auch die Arbeit der Steer-by-Wire-Entwickler kann durchaus Auswirkung auf konventionelle Autos haben: Soll in einem selbstfahrenden Auto das Lenkrad bei Nichtgebrauch im Armaturenbrett verschwinden, ist eine starre Verbindung zu den Rädern mehr als hinderlich. Was aber, wenn der Fahrer eingreifen muss? Wie das Volant im Ernstfall schnellst möglich ausgeklappt werden kann, steht auf einem anderen Blatt, hier geht zunächst darum, was passiert, wenn der händische Eingriff in der Kurve erfolgt: Da sich das Lenkrad nicht mehr zwingend mit dreht, könnten Lenkwinkel und Einschlagwinkel der Räder unterschiedlich sein. Beide möglichst sicher und komfortabel zu synchronisieren, ist eine der zu lösenden Aufgaben.
Hat der Fahrer das Lenkrad in der Hand, stellt sich eher die Frage, wie sich das Lenken anfühlt: Komplexe Berechnungen mit neuronalen Netzen dienen dazu, dass sich die mangels mechanischer Verbindung künstlich erzeugten Lenkkräfte am Volant so natürlich wie möglich anfühlen – oder je nach persönlicher Vorliebe angepasst werden können. Und schließlich erproben die Forscher auch noch, ob ein klassisches Lenkrad überhaupt nötig ist. Der Versuchs-Tiguan beispielsweise lässt sich auch per Handy und Spielekonsolen-Controler steuern. Damit wäre auch ein Fahrerwechsel während der Reise problemlos und ohne anzuhalten möglich. Ob das vielleicht in einem Golf der zehnten Generation auf die Straße kommt, liegt nicht mehr in den Händen der Konzernforschung – die Vorarbeit aber ist zumindest geleistet.