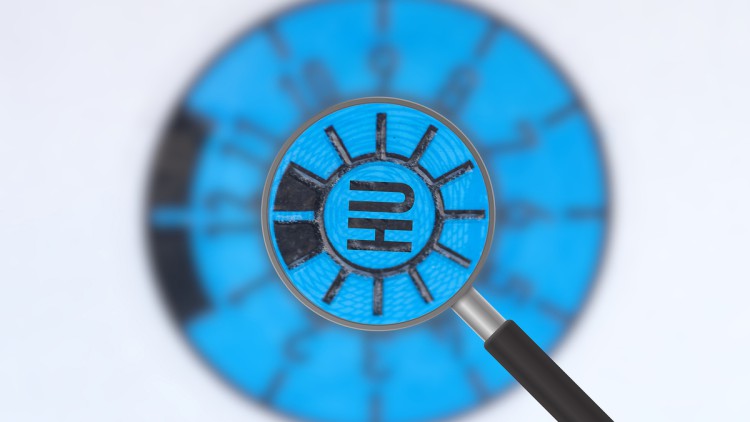Die EU-Kommission will ein ganzes Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Weg bringen. Zu den Vorschlägen gehört auch eine jährliche Hauptuntersuchung (HU) für Autos, die älter als zehn Jahre sind. Bevor der Vorschlag in Kraft treten kann, müssen aber auch noch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen.
EU-Kommission hofft auf weniger Verkehrstote
Der Vorschlag sei eine Maßnahme, die die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfallopfer senken könne, hieß es von der EU-Kommission. Sie rechnet damit, dass die Einführung jährlicher Prüfungen von Pkw und Kleintransportern zu einem Prozent weniger Verkehrstoten und Verletzten führen könne.
Der Vorschlag für die EU-Richtlinie enthält darüber hinaus einen ganzen Strauß an Maßnahmen. So will die EU-Kommission die HU für Elektrofahrzeuge anpassen und neue Prüfpunkte für elektronische Sicherheitssysteme aufnehmen. Dies soll durch die breitere Nutzung der elektronischen Fahrzeugschnittstelle realisiert werden. Zudem soll auch die Softwareintegrität von sicherheits- und emissionsrelevanten Systemen geprüft werden.
Desweiteren will die Kommission neue Emissionsprüfverfahren einführen mit neuen Methoden für ultrafeine Partikel und zur Erfassung von Stickoxiden (NOx).
Die Kommission verweist auf die positiven Erfahrungen mit der Partikelmessung in den Mitgliedstaaten, die sie bereist eingeführt haben (Belgien, die Niederlande und Deutschland). In Deutschland wurde die Überwachung der Emissionen mit der Wiedereinführung der Endrohrmessung in Deutschland im Jahr 2018 sowie der Einführung der neuen Partikelzahlmessung für Euro 6 Diesel ab 1. Juli 2023 deutlich verstärkt.
NOx-Messung: Zunächst für Dieselfahrzeuge
Die NOx-Messung soll zunächst für Dieselfahrzeuge eingeführt werden. Ziel sei es, nicht funktionierenden selektiven katalytischen Reduktionssysteme (SCR) zu identifizieren.
Das Prüfverfahren soll so gestaltet werden, dass es sich an das für die PN-Prüfung angewandte Verfahren anpasst, um eine gleichzeitige PN- und NOx-Prüfung zu ermöglichen. Dadurch würde die Prüfzeit auf dem heutigen Stand gehalten und die zusätzlichen Kosten für die Ausrüstung begrenzt.
Zusätzlich schlägt die Kommission vor, digitale Fahrzeugzulassungen und Prüfbescheinigungen einzuführen, den grenzüberschreitenden Datenaustausch zu vereinfachen und Bürgerinnen und Bürger besser vor betrügerischen Aktivitäten wie Tachomanipulation zu schützen.
Für die Betrugsbekämpfung sollen die Kilometerstände in nationalen Datenbanken hinterlegt sein, außerdem soll der grenzüberschreitende Austausch von Kilometerständen möglich sein. Zur Umsetzung des Vorschlags müssen die Mitgliedstaaten nationale Datenbanken mit den Kilometerständen einrichten. Die Messwerte sollen bei jeder Wartung oder Reparatur des Fahrzeugs erfasst werden.
Auch interessant:
- HU muss digitaler werden: TÜV SÜD erwartet viele Änderungen
- Hauptuntersuchung: Mehr als jedes fünfte Auto fällt durch
- Batterie-Diagnose: Kundenbindungsinstrument
- Tödliche Auto-Defekte: Meist sind die Reifen schuld
Technik verstehen - Vom Scheinwerfer zum Elektromotor
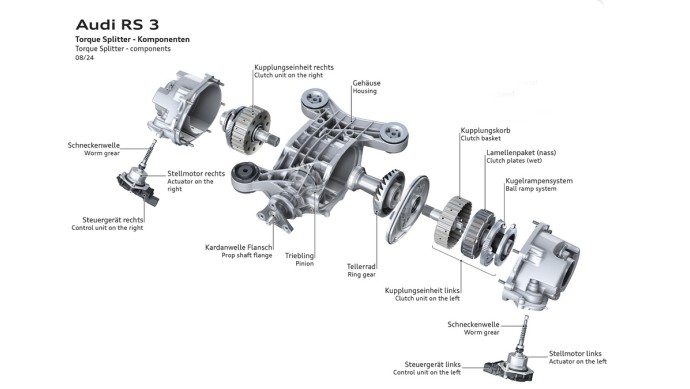 Bildergalerie
Bildergalerie
In Deutschland: HU grundsätzlich alle zwei Jahre
In Deutschland müssen Fahrzeuge in der Regel alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung, unabhängig davon, wie alt ein Fahrzeug ist. Für Neuwagen steht die erste HU erst nach 36 Monaten an. Wer die Frist für den Termin verpasst und sich nicht rechtzeitig eine neue HU-Plakette abholt, muss im Fall einer Fahrzeugkontrolle mit einem Bußgeld rechnen. In vielen EU-Staaten müssen ältere Autos bereits heute jährlich zur PTI (HU).
Der ADAC sieht eine jährliche HU für ältere Fahrzeuge kritisch: "Die Vorschläge der EU-Kommission eine jährliche Pflichtinspektion für Autos einzuführen, die älter als zehn Jahre sind, hält der ADAC nicht für notwendig", teilte der Verkehrsclub mit. Eine Verschärfung der Prüfintervalle, insbesondere in Deutschland, sei nicht angemessen.
Der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V. (ZDK) ist ebenfalls skeptisch. "Der ZDK sieht die in Deutschland gültigen Prüffristen für die Hauptuntersuchung, die bereits heute teilweise über die Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgehen, als vollkommen ausreichend zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an", schreibt der Verband in einem Statement. Aus Sicht des ZDK wäre daher eine weitere Verschärfung der Prüfintervalle bezogen auf das Fahrzeugalter insbesondere in Deutschland nicht angemessen.
Der Verband weist darauf hin, dass die Prüfvorgaben der Hauptuntersuchung in den letzten Jahren aufgrund der komplexeren Fahrzeuge deutlich erweitert wurden. Insbesondere wurde der Fokus dabei auf Assistenzsysteme, E-Mobilität und das Auslesen von Fehlercodes gerichtet. Zudem wurde die Überwachung der Emissionen mit der Wiedereinführung der Endrohrmessung in Deutschland im Jahr 2018 sowie der Einführung der neuen Partikelzahlmessung für Euro 6 Diesel ab 1. Juli 2023 deutlich verstärkt.